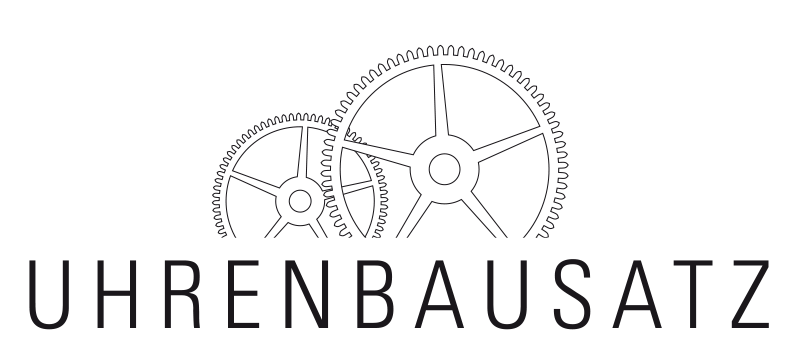A
| Achat | Hartes Mineral, das in hochwertigen Uhren für Steinpaletten verwendet wird. |
| Amplitude | Als Amplitude wird die Halbschwingung* der Unruh* vom Nullpunkt (Mittelstellung) zu den Umkehrpunkten* bezeichnet. |
| Ankergabel | Gabelförmiger Hebelarm des Ankers*. Stellt im Bereich des Nulldurchgangs* über den Hebestein* die Verbindung zwischen Ankerrad* und Unruh* her. |
| Ankerhemmung | Siehe Schweizer Ankerhemmung |
| Ankerpalette | Siehe Palette |
| Ankerrad | Bestandteil der Hemmung*. Es steht mit den Paletten* des Ankers* im Eingriff und ist mit dem Ankerradtrieb vernietet. |
| Ankerstein | Siehe Hebestein |
| Ansteckpunkt | Spiralförmige Proportionalfeder erfunden von dem griechischen Mathematiker Archimedes (285 – 212 vor Christus). Grundform für moderne Spiralfedern*. |
| Archimedische Spirale | Bildet zusammen mit Auslösefeder* und Auslösestein* den charakteristischen Teil der Chronometerhemmung*. |
| Auslösearm | Bildet zusammen mit Auslösefeder* und Auslösestein* den charakteristischen Teil der Chronometerhemmung*. |
| Auslösefeder | Siehe Auslösearm. |
| Auslösestein | Siehe Auslösearm. |
| Auslösung | Durch den Hebestein* hervorgerufene Bewegung des Ankers*, um das Ankerrad* freizugeben. |
B
| Begrenzungsklötzchen | Oder auch Begrenzungsstifte. An diesen liegt die Ankergabel* während des Ergänzungsbogens* der Unruh* an. |
| Bimetall | Bezeichnung für einen Metallstreifen aus zwei (Bi: zwei) miteinander verbundenen Metallen, die sich bei Erwärmung unterschiedlich stark ausdehnen und bei Abkühlung unterschiedlich stark zusammenziehen. Für den Reif einer Kompensations-Unruh* verwendet. |
| Bläuen | Thermische Behandlung von Kohlenstoffstählen. Das feingeschliffene oder polierte Stahlteil wird auf etwa 300° C erwärmt. Dabei bildet sich an der Oberfläche eine Oxydschicht, die für das menschliche Auge in attraktivem Blau erscheint. |
| Blockiernasen | Teile der Zahnradstellung* des Federhauses*. Ermöglichen die Begrenzung von Aufzug und Ablauf der Zugfeder*. |
| Bombieren | Wölben. Besonders bei Zeigern edler Uhren gerne angewandte Methode zur Steigerung der optischen Attraktivität. Die als Zubehör erhältlichen, aufwändig in Handarbeit bombierten, polierten und gebläuten* Zeiger sind kleine Meisterwerke, die das Zifferblatt Ihrer Mechanica M2 aufwerten. |
| Breguet, Abraham-Louis (1747 – 1823) | Breguet ist einer der bedeutendsten Uhrmacher der Geschichte und lieferte Uhren an den englischen König und Napoleon I. Er verbesserte die Gangergebnisse durch die nach ihm benannte Breguet-Spirale mit aufgebogener Endkurve*. Außerdem erfand er das Tourbillon, produzierte geniale Schlagwerke, designte die Breguet-Zeigerform und baute hochwertige Chronographen und Marinechronometer*. |
| Bronze | Legierungen aus mehr als 60% Kupfer und Zinn. Im Unterschied dazu ist Messing* eine Legierung aus Kupfer und Zink. |
C
| Chaton | Im feinen Uhrenbau verwendetes Messingfutter mit eingepresstem Rubinlochstein. Wird in der Platine verschraubt und kann leicht ausgetauscht werden. |
| Chronometerhemmung | Sehr genaue aber auch aufwändige und empfindliche Hemmung* für Präzisionschronometer. |
| CNC | Computer Numeric Controlled. Die Fertigung der präzisen Werkbauteile Ihrer Präzisionsuhr erfolgt in unserer Manufaktur mit Hilfe computergesteuerter Dreh- und Fräsmaschinen. |
D
| Drehmoment | Produkt aus Kraft und Hebelarm. |
| Duplex-Hemmung | Ankerlose Hemmung* mit Doppelrad (Ruhezähne und Stoßzähne) ursprünglich verwendet für hochwertige Chronometer. |
E
| Echappement | Austauschbare Einheit oder Baugruppe bestehend aus Unruh* und den Hemmungsteilen. Zur optischen Aufwertung ist ein aufwändig finissiertes*, rhodiniertes, diamantgefrästes Echappement mit Schraubenunruh*, blauer Spirale* und blauen Schrauben erhältlich. |
| Edelstahl | Durch Legieren mit anderen Metallen wie Nickel oder Chrom gewinnt der Stahl spezielle Eigenschaften, zum Beispiel erhöhte Korrosionsbeständigkeit. |
| Eingriff | Das Ineinandergreifen von Rad* und Trieb* oder zweier Zahnräder nennt man Eingriff. Die Kraftübertragung wird umso besser, je mehr Zähne sich dabei gleichzeitig berühren. |
| Ellipse | Anderer Name für Hebestein* aufgrund seiner ursprünglich elliptischen Form. |
| Eloxieren | Elektrochemisches Altern von Aluminium. Bei dem speziellen Verfahren wird die Werkstoffoberfläche in Säurebädern behandelt, wodurch sich eine sehr widerstandsfähige Oxydschicht bildet. Mit dem eckigen Zifferblatt aus hart eloxiertem Aluminium mit aufgesetzter Stundenskalierung nähert sich Ihre Mechanica M2 optisch den aktuellen Modellen und Vorbildern Metrica und Pandera aus der Großuhrenmanufaktur Erwin Sattler an. |
| Endkurve | Ausformung des Endes einer Spirale* das sicherstellt, dass der Schwerpunkt beim Ein- und Ausschwingen im Zentrum verbleibt. |
| Englische Hemmung | Siehe Spitzzahn-Ankerhemmung. |
| Ergänzungsbogen | Schwingungsphase der Unruh*. Der Weg vom Ende des Falls* bis zum Umkehrpunkt* wird als ausgehender Ergänzungsbogen bezeichnet. Der Weg vom Umkehrpunkt bis zur Auslösung* ist der eingehende Ergänzungsbogen. |
F
| Facettierte Gläser | Austauschbare Einheit oder Baugruppe bestehend aus Unruh* und den Hemmungsteilen. Zur optischen Aufwertung ist ein aufwändig finissiertes*, rhodiniertes, diamantgefrästes Echappement mit Schraubenunruh*, blauer Spirale* und blauen Schrauben erhältlich. |
| Fall | Durch Legieren mit anderen Metallen wie Nickel oder Chrom gewinnt der Stahl spezielle Eigenschaften, zum Beispiel erhöhte Korrosionsbeständigkeit. |
| Federhaus | Das Ineinandergreifen von Rad* und Trieb* oder zweier Zahnräder nennt man Eingriff. Die Kraftübertragung wird umso besser, je mehr Zähne sich dabei gleichzeitig berühren. |
| Feinreglage | Elektrochemisches Altern von Aluminium. Bei dem speziellen Verfahren wird die Werkstoffoberfläche in Säurebädern behandelt, wodurch sich eine sehr widerstandsfähige Oxydschicht bildet. Mit dem eckigen Zifferblatt aus hart eloxiertem Aluminium mit aufgesetzter Stundenskalierung nähert sich Ihre Mechanica M2 optisch den aktuellen Modellen und Vorbildern Metrica und Pandera aus der Großuhrenmanufaktur Erwin Sattler an. |
| Finissage | Ausformung des Endes einer Spirale* das sicherstellt, dass der Schwerpunkt beim Ein- und Ausschwingen im Zentrum verbleibt. |
| Foliot | Teil der Spindelhemmung*. Französicher Name für Waag*. |
| Freie Ankerhemmung | Die Unruh* erhält nur beim Nulldurchgang* für einen kurzen Moment über Ankergabel* und Hebestein* einen Kraftimpuls. Während der Ruhephase des Ankerrads* kann die Unruh frei schwingen und es besteht keine mechanische Verbindung zum Räderwerk*. |
| Friktion | Reibung. Generell wurde bei der Konstruktion Ihrer Präzisionsuhr größter Wert auf die Verminderung auftretender Reibung gelegt. Deshalb sind die meisten Räderwerkswellen mit Kugellagern* ausgestattet. Andererseits kann Friktion auch gezielt zum Einsatz kommen, beispielsweise als Rutschkupplung im Zeigerwerk*, um ein Stellen der Zeiger zu ermöglichen. |
G
| Gabelmesser | Oder auch Sicherheitsstift. Bauteil der Schweizer Ankerhemmung*. Sichert zusammen mit der Sicherheitsrolle* den Eingriff von Hebestein* und Ankergabel*. |
| Galilei, Galileo (1564 – 1642) | Italienischer Mathematiker, Physiker und Astronom. Um 1590 untersuchte er das Pendel und entdeckte, das die Schwingungsperiode nicht vom Gewicht, sondern von der Länge bestimmt wird. Er beschäftigte sich in der Folge bis in seine letzten Lebensjahre immer wieder mit Konzepten für eine Pendeluhr, hat diese aber nie gebaut. |
| Galoppieren | Zufälliger Durchgang von mehreren Hemmungsradzähnen statt nur einem. Kommt vor bei Erschütterungen in Chronometer- und Duplex-Hemmungen. |
| Gang | Unter dem täglichen Gang einer Uhr versteht der Fachmann die in einem Zeitraum von 24 Stunden im Vergleich zu einer Normaluhr (z.B. Funkuhr) auftretende Differenz der Zeitanzeige der zu prüfenden Uhr. |
| Gangdauer | Unterteilt die gleichförmige Bewegung des Räderwerks* in einzelne, zeitgleiche Abschnitte. Bei mechanischen Uhren dienen Pendel*, Unruh* oder Waag* als Gangregler oder Taktgeber. |
| Gangregler | Teil der Spindelhemmung*. Französicher Name für Waag*. |
| Gebläut | Siehe Bläuen. |
| Gegengewicht | Der Minutenzeiger ist ein einarmiger Hebel, der durch die Einwirkungen der Schwerkraft halbstündlich wechselnd dem Uhrwerk Kraft zuführen oder entziehen würde. Um dem vorzubeugen, wird unter dem Zifferblatt auf der Minutenzeigerwelle ein Gegengewicht angeordnet, wodurch der Schwer – punkt der Baugruppe in die Drehungsachse fällt und keine negativen Auswirkungen auf den genauen Gang* der Uhr ausüben kann. |
| Gesperr | Ermöglicht den Aufzug und verhindert über Sperrad* und Sperrklinke* den Ablauf der Zugfeder. Diese kann sich somit nur über das Räderwerk* entspannen. |
| Gleitlager | Lagerstelle, wobei der Lagerzapfen in einer Lagerbohrung gelagert ist. Da die Materialoberflächen aufeinander gleiten, ist neben der Wahl unterschiedlicher Werkstoffe unbedingt ein Schmiermittel zu verwenden. |
| Glucydur | Abgeleitet von Glucinium (französisch für Beryllium) und dur (französisch: hart) zusammen. Sehr harte Legierung aus Kupfer und 2-3% Beryllium, nicht magnetisch, nicht oxidierend mit sehr geringer Wärmeausdehnung. Auch Berylliumkupfer genannt. |
| Graham, George (ca. 1673 – 1751) | Nach seiner Lehrzeit arbeitete Graham bei dem einflussreichen englischen Uhrmacher Thomas Tompion in London, mit dem er bis zu dessen Tod eng befreundet war. Graham wurde Teilhaber Tompions und heiratete dessen Nichte Elizabeth. Graham entwickelte das Quecksilber-Kompensationspendel und vor allem 1715 die nach ihm benannte, revolutionäre ruhende Ankerhemmung*. |
| Graham-Hemmung | Aufgrund der speziellen Form der Ankerpaletten* steht das Ankerrad* während der sogenannten »Ruhe*« still. Die Grahamhemmung ermöglichte einen enormen Fortschritt in der Präzisionszeitmessung und hat sich seit Jahrhunderten selbst in feinsten Uhren hervorragend bewährt. |
| Guillaume, Charles-Edouard (1861 – 1938) | Der französisch-schweizerische Physiker arbeitete unter anderem an der Definition des Urmeters und entdeckte 1896 die Invar*-Legierung mit extrem kleiner Wärmeausdehnung, für die er 1920 den Nobelpreis erhielt. |
H
| Halbschwingung | Auslenkung des Pendels* oder der Unruh* zwischen zwei Umkehrpunkten*. |
| Harrison, John (1693 – 1776) | Harrison war gelernter Schreiner, betätigte sich aber schon bald als Uhrmacher. Nach dem anfänglichen Bau von revolutionären Turm- und Standuhren aus Holz, konzentrierte er sich ab 1730 für sein gesamtes Leben auf den Bau und die Optimierung von Marinechronometern für die britische Admiralität. 1761 bewies sein Sohn William auf einer Erpobungsfahrt nach Jamaika die unglaubliche Präzision der genialen H4. |
| Hebefläche | Fläche an den Ankerpaletten*. Auf der schiefen Ebene der Hebefläche gleitet die Zahnspitze des Ankerrads* während der Hebung* ab und erteilt so dem Gangregler* einen Antriebsimpuls. |
| Hebescheibe | Auch große Rolle genannt. Sitzt auf der Unruhwelle und trägt den Hebestein*. |
| Hebestein | Auch Hebelstein, Ellipse oder Ankerstein genannt. Sitzt auf der Hebescheibe* der Unruh* und greift im Bereich des Nulldurchgangs* in die Ankergabel* ein. |
| Hebung | Phase der Hemmung*, während der die Impulsübertragung zum Antrieb des Pendels* oder der Unruh* erfolgt. |
| Hemmung | Baugruppe bestehend aus Ankerrad* und Anker*. Die Hemmung erteilt dem Gangregler* die zum Erhalt der Schwingung notwendige Energie und hemmt gleichzeitig das Räderwerk* am vorzeitigen Ablauf. |
| Hemmungsrad | Siehe Ankerrad. |
| Huygens, Christiaan (1629 – 1695) | Niederländischer Astronom, Mathematiker und Physiker. Er nutzte die Erkenntnisse von Galileo Galilei* für seine Untersuchungen der Pendelbewegung und entdeckte dass die Schwingung des Pendels unabhängig von der Auslenkung ist. Schließlich entwickelte er eine Pendeluhr und meldete diese 1664 zum Patent an. 1675 entwickelte er das Unruhschwingsystem mit Archimedischer* Spiralfeder* und baute damit Taschenuhren. |
I
| Invar | Abgeleitet von invariabel (unveränderlich). Eine spezielle Eisen-Nickel Legierung aus 36,8% Ni (Nickel), Rest Fe (Eisen). Die Längenausdehnung von getempertem* Invar ist bei Temperaturschwankungen etwa zehn mal geringer als bei Stahl. Die besondere Zusammensetzung wurde nach umfangreichen Studien 1896 von Charles Édouard Guillaume* gefunden und von Sigmund Riefler* noch im selben Jahr erstmals als Werkstoff für Pendelstäbe in Präzisionsuhren verwendet. |
| Isochronismus | Zeitgleichheit der einzelnen Schwingungen des Gangreglers*. |
K
| Kaliber | Typbezeichnung eines Uhrwerks. |
| Kleinbodenrad | Zahnrad im Räderwerk*. Es sitzt auf dem Kleinbodentrieb und überträgt die Antriebskraft vom Minutenrad* zum Ankerradtrieb. |
| Klötzchenträger | Meist verstellbarer Hebelarm am Unruhkloben* an dem das äußere Ende der Spiralfeder* montiert wird. |
| Kolbenzahn- Ankerhemmung | Im Gegensatz zur Englischen Spitzzahn-Ankerhemmung* erfolgt bei der Schweizer Kolbenzahn-Ankerhemmung die Hebung* nicht nur auf den Hebeflächen* der Ankerpaletten, sondern auch auf den Ankerradzähnen. |
| Kronrad | Die Verwendung eines Kronrads als Ankerrad* ermöglicht den Aufbau eines einfachen Winkelgetriebes. Wurde früher in der Spindelhemmung* verwendet. |
| Kugellager | Wälzlager, bei dem Kugeln in einer Rille zwischen dem Innen- und dem Außenring abrollen. Da die dabei auftretende Rollreibung sehr gering ist, zeichnen sich Kugellager durch geringste Reibungsverluste und nahezu keinen Verschleiß aus. Bei den geringen Belastungen der in Ihrer Präzisionsuhr verwendeten Edelstahl*-Kugellager benötigen diese kein Öl. |
L
| Le Roy, Pierre (1717 – 1785) | Französischer Uhrmacher und einer der herausragenden Pioniere auf dem Gebiet des Chronometerbaus. Er erfand unter anderem eine freie Chronometerhemmung und eine Chronometerunruh aus Bimetall*. 1754 begann er mit dem Bau von Marinechronometern*. |
| Lünette | Zierreif für das Zifferblatt. |
M
| Marinechronometer | Präzisions-Chronometer, die in der Seefahrt für die Navigation verwendet wurden und über die genaue Uhrzeit die Bestimmung des Längengrads ermöglichten. |
| Masse-Feder-System | Mechanisches Schwingsystem dessen Eigenfrequenz durch den zyklischen Wechsel von dynamischer Energie (Bewegung einer Masse) und statischer Energie (Lageenergie beim Pendel* bzw. Federkraft der Spiralfeder*) bestimmt wird. |
| Messing | Legierung aus Kupfer und Zink. Die Zahnräder sind aus Messing und wurden zum Schutz gegen Korrosion und zur Oberflächenveredelung vergoldet. |
| Minutenrad | Zahnrad auf der Minutenzeigerwelle. Es sitzt vernietet auf dem Minutentrieb, dreht sich einmal in der Stunde und überträgt die Antriebskraft vom Beisatzrad* auf das Kleinbodentrieb. |
| Monatsgangdauer | Siehe Gangdauer. |
| Mudge, Thomas (1715 – 1794) | Genialer Englischer Uhrmacher; erfand 1759 die freie Ankerhemmung. Ging bei dem berühmten George Graham* in die Lehre und übernahm nach dessen Tod das Geschäft. Mudge setzte als einer der ersten Uhrmacher Steinlager ein und optimierte Chronometergänge für Marinechronometer*. |
N
| Nivarox | Abgeleitet von nicht variabel und oxydfest. Nichtmagnetische, korrosionsbeständige und temperaturkompensierte Eisen-Nickel-Legierung zur Herstellung von Spiralfedern*. |
| Nulldurchgang | Ereignis im Ablauf der Hemmung*, wenn der Hebestein* in der Nähe des Nullpunkts* in die Ankergabel* eingreift. |
| Nullpunkt | Auch toter Punkt genannt. Gleichgewichts- bzw. Ruhestellung der Unruh* oder des Pendels*. |
O
| Ölsenkung | Bei Gleitlagern* halbkugelförmige Höhlung an der äußeren Lager – lochöffnung. Die Ölsenkung dient zur Aufnahme eines kleinen Ölvorrats. |
| Oszillator | Schwingungs- oder Zeitteilungsorgan. In mechanischen Uhren sind dies Pendel* und Unruh*, die auch als Gangregler* bezeichnet werden. |
| Oszillogramm | Hochgenaue Darstellung von elektrischen oder zeitlichen Vorgängen auf dem Bildschirm eines Messgeräts. In der Uhrmacherei verwendet bei Zeitwaagen* für die Bestimmung der Ganggenauigkeit. |
P
| Palette | Funktionsteil des Ankers* aus gehärtetem Stahl oder Stein. Die Paletten sind in den Ankerkörper eingesetzt. Die polierten schrägen Schnittflächen heißen Hebeflächen*. |
| Pendel | Auch heute noch das genaueste mechanische Schwingsystem. Die Schwingungsdauer* wird durch die Pendellänge und die Erdanziehung bestimmt. |
| Pfeiler | Auch Werkpfeiler genannt. Abstandshalter zwischen den Werkplatinen*, sie bilden mit diesen das Werkgestell. |
| Phillips, Edouard (1821- 1889) | Französischer Ingenieur. Befasste sich intensiv mit den von Abraham-Louis Breguet* empirisch ermittelten Endkurven* für Spiralfedern* und lieferte den mathematischen Nachweis. Erforschte Schwerpunkt und Isochronismus* von Spiralfedern* als Grundlagen für die Präzisionsreglage. |
| Platinen | Werkplatten einer Uhr. Dienen zur Aufnahme der Lagerstellen und zur Fixierung der übrigen Werkbauteile. |
| Präzisionspendeluhr | Konstruktiv und fertigungstechnisch bedingungslos umgesetztes Zeitmessgerät, das sich durch hohe Gangleistungen auszeichnet. Pendeluhren mit kompensierten Pendeln* wurden bis in die späten 1960-er Jahre als Zeitnormale für wissenschaftliche Zwecke und für die offizielle Zeitbestimmung eingesetzt. |
R
| Rad | In der Uhrmacherei werden hohe Übersetzungsverhältnisse* ins Schnelle verwendet. Dabei wird das größere antreibende Zahnrad als Rad und das kleinere angetriebene Zahnrad als Trieb* bezeichnet. |
| Räderwerk | Zahnradgetriebe in einer Uhr. Das Räderwerk überträgt die Antriebskraft an die Hemmung*. Es ist so berechnet, dass sich einzelne Wellen* in bestimmten Geschwindigkeiten drehen. Im Räderwerk kommen üblicherweise vier Räder zum Einsatz: Walzenrad*, Beisatzrad*, Minutenrad* und Kleinbodenrad*. Das Ankerrad* wird nicht als Teil des Räderwerks angesehen. |
| Reglage | Einstellung oder Regulierung der Schwingungsdauer* des Uhrwerks. |
| Riefler, Sigmund (1847 – 1912) | Sigmund Riefler übernimmt 1876 nach dem Tod des Vaters mit Unterstützung seiner Brüder die Reißzeugfirma Clemens Riefler. Er entwickelt 1877 ein revolutionäres Zirkel-Rundsystem, mit dem er weltweit bekannt wird. 1878 zieht er nach München, wo er 1889 seine schon 1869 entwickelte freie Hemmung entscheidend verbessert und schließlich patentieren lässt. Riefler baute die genauesten Präzisionspendeluhren seiner Zeit und wurde dafür 1897 von der Universität München zum Dr. phil. h.c. ernannt. |
| Riefler-Hemmung | Bei der Rieflerschen freien Hemmung ist das Pendel in einem um Schneiden drehbaren Rahmen aufgehängt und wird lediglich durch zusätzliche Biegung der Aufhängefeder angetrieben. Für Hebung und Ruhe verwendet Riefler ein spezielles Doppel-Gangrad. Die Riefler-Hemmung ermöglicht hervorragende Gangergebnisse ist aber durch die Aufhängung der Schneiden in Lagersteinen kompliziert einzustellen und relativ empfindlich. |
| Rubin | Sehr hartes Mineral aus der Familie des Korund. Synthetische Rubine werden in hochwertigen Uhren als Lagersteine verwendet. |
| Rückerschlüssel | Teil der Rückervorrichtung, in dem das äußere Ende der Spiralfeder* geführt und somit die wirksame Länge eingestellt wird. |
| Rückerzeiger | Teil des Echappements*, über das die wirksame Länge der Spiralfeder* und damit die Schwingfrequenz verändert werden kann. |
| Rückführende Hemmung | Auch rückfallende Hemmung* genannt. Frühe Hemmungsbauart, bei welcher der Gangregler* nahezu permanent mit dem Hemmungsrad* im Eingriff steht und dadurch bei jeder Schwingung auch eine rückläufige Bewegung erzwingt. |
| Ruhe | Als Ruhe wird die kleine Distanz auf der Ruhefläche* bezeichnet, die der Ankerradzahn vom Punkt des Auftreffens auf die Ruhefläche* bis zum Abgleiten auf die Hebefläche* zurücklegt. Die Ruhe ist eine notwendige Sicherheitsgröße, die verhindert, dass der Ankerradzahn direkt auf die Hebefläche* auftritt und damit das Weiterschwingen der Unruh* blockiert. |
| Ruhefläche | Bezeichnung für den äußeren Radius der Eingangspalette und den inneren Radius der Ausgangspalette, auf welche die Zähne des Ankerrads* für die Hemmung* des Räderwerks* fallen. |
| Ruhende Hemmung | Verbesserung der rückführenden Hemmung* und Vorläufer der freien Hemmung*. Bei der ruhenden Hemmung ist der Gangregler* erstmals nicht mehr permanent mit dem Hemmungsrad* verbunden, sondern ruht während des Ergänzungsbogens*. Er bewegt sich somit nur schrittweise vorwärts. |
S
| Schraubenunruh | In hochwertigen klassichen Uhrwerken verwendete Unruh* mit Schrauben zur Veränderung des Trägheitmoments. |
| Schweizer Ankerhemmung | Sehr weit verbreitete freie Ankerhemmung* für tragbare Uhren. Das als Zubehör erhältliche, im Sekundenkreis durchbrochene runde Zifferblatt gibt den Blick frei auf das Echappement*, dem ansonsten verborgenen Herzstück Ihrer Mechanica M2. Besonders attraktiv ist der freie Blick natürlich auf das aufwändig finissierte Echappement mit Schraubenunruh, gebläuter Spiralfeder* und gebläuten Schrauben. |
| Schwingungsdauer | Genau genommen ist dies die Zeit, welche die Unruh* benötigt, um von einem Umkehrpunkt* zum anderen und wieder zurück zu schwingen. Traditionsgemäß betrachten die Uhrmacher jedoch nur die Zeit von einem Umkehrpunkt zum anderen und bezeichnen dies als Halbschwingung*. |
| Sekundenrad | Zahnrad auf der Welle des Sekundenzeigers. Es sitzt vernietet auf dem Sekundentrieb und dreht sich einmal in der Minute. Das Sekundenrad übersetzt die 18.000 Halbschwingungen pro Stunde (2,5 Hertz) des Echappements* auf den Sekundenzeiger und überträgt die Antriebskraft vom Kleinbodenrad* auf das Ankerradtrieb. |
| Sicherheitsrolle | Auch kleine Rolle genannt. Bauteil der Schweizer Ankerhemmung*. Ist auf der Unruhwelle direkt über der Hebescheibe* angeordnet und sichert zusammen mit dem Sicherheitsstift* den Eingriff von Hebestein* und Ankergabel*. |
| Sicherheitsstift | Siehe Gabelmesser. |
| Simplex-Hemmung | Hemmung* mit einfachem Hemmungsrad*. Im Gegensatz zum Doppelrad bei der Duplex-Hemmung*. |
| Sperrfeder | Siehe Gesperr. |
| Sperrklinke | Siehe Gesperr. |
| Sperrrad | Siehe Gesperr. |
| Spindelhemmung | Erste mechanische Hemmung* für Grossuhren mit einem auf einer Spindel angeordneten Schwingbalken. |
| Spindellappen | Übernehmen bei der Spindelhemmung* die Funktion der Ankerpaletten. |
| Spiralfeder (Spirale) | Filigrane, in Form einer Archimedischen Spirale* aufgerollte Feder. Die beiden Enden sind über den Klötzchenträger* am Unruhkloben* und über die Spiralrolle* mit der Unruh* verbunden. Bildet zusammen mit der Unruh ein Schwingsystem. |
| Spiralklötzchen | Fixiert das äußere Ende der Spiralfeder* und ist im Klötzchenträger* verschraubt. |
| Spiralrolle | Sitzt auf der Unruhwelle und fixiert das innere Ende der Spiralfeder*. |
| Spitzzahn-Ankerhemmung | Auch Englische Hemmung genannt. Frühe Form der Steinankerhemmung mit spitzen Zähnen. Hier erfolgt die Hebung* nur an den Paletten*. Diente als Grundlage für die spätere Entwicklung der Schweizer Kolbenzahn- Ankerhemmung*. |
| Stahlwelle | Siehe Welle. |
| Stand | Wert, um den die Anzeige Ihrer Uhr gegenüber der Referenzzeit abweicht. |
| Steinankerhemmung | Überbegriff für alle Hemmungen* deren Anker* mit Steinpaletten versehen ist. |
| Stellungsräder | Ermöglichen zusammen mit den Blockiernasen* der Zahnradstellung*am Federhaus* die Begrenzung für Aufzug und Ablauf der Zugfeder*. |
| Strasser, Ludwig (1853 – 1917) | Professor Ludwig Strasser ist der Erfinder der nach ihm benannten freien Federkrafthemmung, Mitbegründer der Glashütter Firma Strasser & Rohde und späterer Leiter der deutschen Uhrmacherschule in Glashütte. |
| Strasser-Hemmung | Die Besonderheit dieser freien Federkrafthemmung besteht darin, dass das Räderwerk über eine zusätzliche Antriebsfeder weitgehend vom Schwingungssystem entkoppelt ist und somit nahezu frei schwingen kann. Damit ließen sich die schon hervorragenden Gangergebnisse von Präzisionspendeluhren nochmals steigern. |
| Straumann Dr., Reinhard | Der innovative Schweizer Ingenieur entwickelte 1931 die selbstkompensierende (temperaturunabhängige) Nivarox*-Legierung zur Herstellung von Spiralfedern*. |
| Stundenrad | Bauteil des Zeigerwerks*. Das Stundenrad wird vom Wechseltrieb* ange – trieben und dreht sich einmal in zwölf Stunden. Der Stundenzeiger wird auf dem mit dem Stundenrad fest verbundenen Stundenrohr aufgesetzt. |
| Superinvar | Besonders aufwändig getempertes* Invar* mit sehr gleichmäßigem Temperaturverhalten. |
T
| Teilung | Der Abstand von Zahnmitte bis zur nächsten Zahnmitte, gemessen am Umfang des wirksamen Kreises oder Teilkreises eines Rads*. |
| Tempern | Wärmebehandlung der Invarpendelstäbe zum Abbau der Material – spannungen. Nur durch das aufwändige Tempern kann das konstante Temperaturverhalten der Pendelstäbe erreicht werden. |
| Tompion, Thomas (1638 – 1713) | Englischer Uhrmacher; gilt als Erfinder der Zylinderhemmung*, der ersten ruhenden Hemmung* für tragbare Uhren. Diese wurde von Tompions Schüler, Freund und späteren Teilhaber George Graham* weiter verbessert. Tompion baute eine der ersten Taschenuhren mit Spiralfeder*. |
| Toter Punkt | Siehe Nullpunkt. |
| Trieb | Zahnrad mit weniger als 20 Zähnen; meist aus Stahl. Üblicherweise sind fünf gehärtete Stahltriebe eingebaut: Beisatztrieb, Minutentrieb, Kleinbodentrieb, Ankerradtrieb und Wechseltrieb. |
U
| Übersetzung | Drehmomentübertragung* in einem Eingriff*. Dabei ändern sich von einer Welle* zur anderen die Drehrichtung und die Drehzahl. |
| Übersetzungsverhältnis | Bezeichnet die Übersetzung eines im Eingriff* befindlichen Räderpaars und berechnet sich aus der Zahnzahl des Rads* und der Triebzahnzahl. Das Übersetzungsverhältnis gibt an wie oft sich das angetriebene Zahnrad (Trieb*) bei einer Umdrehung des treibenden Zahnrads (Rad*) dreht. |
| Uhrenstand | Siehe Stand. |
| Umkehrpunkt | Am Ende des Ergänzungsbogens* wird die Unruh* durch die Spiralfeder* zuerst bis zum Stillstand abgebremst und anschließend in der entgegengesetzten Drehrichtung wieder beschleunigt. |
| Unruh | Die Unruh bildet mit der Spiralfeder* ein Schwingsystem und gewährleistet zusammen mit der Hemmung* den gleichmäßigen Lauf einer Uhr. |
| Unruhkloben | Teil des Echappements* auf dem Rückerzeiger*, Rückerschlüssel* und Klötzchenträger* befestigt sind. |
| Unwucht | Zustand eines sich drehenden Teils (z.B. Unruh*), wenn dessen Schwerpunkt nicht in der Drehachse liegt. |
V
| Viertelrad | Bauteil des Zeigerwerks*, wird auf die Minutenradwelle gesetzt. Es treibt das Wechselrad* an. |
W
| Waag | Drehwaage oder Schwingbalken mit verstellbaren Gewichten. Wurde in frühen Räderuhren mit Spindelhemmung* als Gangregler* verwendet. |
| Wechselrad | Bestandteil des Zeigerwerks*. Es sitzt mit dem Wechseltrieb auf dem Wechselradpfosten, wird vom auf der Minutenradwelle sitzenden Viertelrad* angetrieben und treibt selbst das Stundenrad* an. |
| Welle | Achse im Uhrwerk. |
| Werkpfeiler | Siehe Pfeiler. |
| Werkplatinen | Siehe Platinen. |
| Wolfram | Sehr schweres Metall, Dichte 19,3 kg/dm. |
Z
| Zahnradstellung | Einrichtung aus Stellungsrädern* und Blockiernasen* die zwischen Federhauswelle und Federhaus* montiert ist. Ermöglicht die Begrenzung für Aufzug und Ablauf der Zugfeder*. |
| Zapfen | Dünneres, abgesetztes Wellenende. Über die Zapfen werden die Wellen* in den Lagerbohrungen geführt. In Präzisionsuhren sind die Zapfen durchgehärtet und bilden zusammen mit Welle* und Trieb* ein gemeinsames Bauteil. |
| Zeigerwerk | Baugruppe mit zwei Zahnradeingriffen. Überträgt die Bewegung des Minutenzeigers zwölffach verlangsamt auf die Welle* des Stundenzeigers. Das Zeigerwerk besteht aus Viertelrad*, Wechselrad*, Wechseltrieb und Stundenrad*. |
| Zeitwaage | Elektronisches Messgerät für die exakte Bestimmung der momentanen Ganggenauigkeit eines Uhrwerks. Dazu werden mit einem hochempfindlichen Mikrofon die Geräusche der Hemmung* erfasst und ausgewertet. |
| Zugfeder | Für den Antrieb des Uhrwerks wird im Federhaus* eine spiralförmig aufgerollte Stahlfeder verwendet. Damit die Federkraft über die Gangdauer* möglichst konstant bleibt, wird eine sogenannte Zahnradstellung* verwendet. |
| Zykloide | Rolllinie. Eine geometrische Kurve, die durch Abrollen eines Kreises auf einer geometrischen Kontur entsteht. Die Zykloide hat sich in der Uhrmacherei seit Generationen als optimale Kontur für Uhrwerksverzahnungen bewährt. |
| Zylinderhemmung | Die Zylinderhemmung war die erste ruhende Hemmung* und stellte eine wesentliche Verbesserung gegenüber den zuvor üblichen rückführenden Hemmungen* dar. Allerdings reiben hier während der Ergänzungsbögen* die Zahnspitzen am Zylinder und verhindern so eine freie Schwingung. |
Abfalleinsteller
Vorrichtung zur Justage der Gangsymmetrie*. Mittels der Rändelschraube am Abfalleinsteller wird die Ankerwelle im Verhältnis zum Pendel* so verdreht, dass zu beiden Seiten der Ankerbewegung ein gleich großer Ergänzungsbogen* des Pendels und somit ein gleichmäßiges Tickgeräusch erzielt wird.
Achat
Hartes Mineral, das in hochwertigen Uhren für Steinpaletten verwendet wird.
Amplitude
Tischuhr: Als Amplitude wird die Halbschwingung* der Unruh* vom Nullpunkt (Mittelstellung) zu den Umkehrpunkten* bezeichnet.
Pendeluhr: Als Amplitude wird die Halbschwingung* des Pendels* von der Nulllage (Mittelstellung) zu den Umkehrpunkten* bezeichnet. Auf der Pendelskala kann die Amplitude in Winkelminuten abgelesen werden.
Aneroiddosenkompensation
Eine Möglichkeit, die Einflüsse des schwankenden Luftdrucks auf die Ganggenauigkeit der Uhr mit Hilfe eines Barometerinstruments* auszugleichen.
Ankerbrücke
Die Ankerbrücke wird mit der Hinterplatine verschraubt und dient als Aufnahme für das Exzenterlager* in dem eine Seite der Ankerwelle gelagert ist.
Ankergabel
Tischuhr: Gabelförmiger Hebelarm des Ankers. Stellt im Bereich des Nulldurchgangs* über den Hebestein* die Verbindung zwischen Ankerrad* und Unruh* her.
Pendeluhr: Ein Hebelarm, über den der Anker* mit dem Gangregler* (Pendel*) verbunden wird.
Ankerhemmung
Tischuhr: Siehe Schweizer Ankerhemmung.
Ankerpalette
Siehe Palette.
Ankerrad
Bestandteil der Hemmung*. Es dreht sich bei Ihrer Mechanica M1 alle 60 Sekunden einmal und ist mit einer Buchse auf der Ankerradwelle befestigt. Auf dem vorderen Wellenende ist der Sekundenzeiger angebracht.
Beisatzrad
Bestandteil des Räderwerks*. Es sitzt fest vernietet auf dem Beisatztrieb und sorgt für eine 30-tägige Gangdauer der Uhr. Es überträgt die Antriebskraft auf das Minutentrieb.
Bläuen
Thermische Behandlung von Kohlenstoffstählen. Das feingeschliffene oder polierte Stahlteil wird auf etwa 300° C erwärmt. Dabei bildet sich an der Oberfläche eine Oxydschicht, die für das menschliche Auge in attraktivem Blau erscheint.
Bombieren
Wölben. Besonders bei Zeigern edler Uhren gerne angewandte Methode zur Steigerung der optischen Attraktivität. Für Ihre Mechanica M1 stehen zur optischen Aufwertung aufwändig in Handarbeit bombierte, polierte und gebläute* Zeigersätze als Zubehör zur Verfügung.
Bronze
Legierungen aus mehr als 60% Kupfer und Zinn. Im Unterschied dazu ist Messing* eine Legierung aus Kupfer und Zink.
Chaton
Im feinen Uhrenbau verwendetes Messingfutter mit eingepresstem Rubinlochstein. Wird in der Platine verschraubt und kann leicht ausgetauscht werden.
CNC
Computer Numeric Controlled. Die Fertigung der präzisen Werkbauteile Ihrer Mechanica M1 erfolgt in unserer Manufaktur mit Hilfe computergesteuerter Dreh- und Fräsmaschinen.
Drehmoment
Produkt aus Kraft und Hebelarm.
Edelstahl
Durch Legieren mit anderen Metallen wie Nickel oder Chrom gewinnt der Stahl spezielle Eigenschaften, zum Beispiel erhöhte Korrosionsbeständigkeit.
Eloxieren
Elektrochemisches Altern von Aluminium. Bei dem speziellen Verfahren wird die Werkstoffoberfläche in Säurebädern behandelt, wodurch sich eine sehr widerstandsfähige Oxydschicht bildet. Bei Ihrer Mechanica M1 sind zahlreiche mechanisch gering belastete Bauteile, beispielsweise Platinen*, Ankerkörper und Seilwalze* aus eloxiertem Aluminium.
Eingriff
Das Ineinandergreifen von Rad* und Trieb* oder zweier Zahnräder nennt man Eingriff. Die Kraftübertragung wird umso besser, je mehr Zähne sich dabei gleichzeitig berühren.
Ergänzungsbogen
Schwingungsphase des Pendels. Den Weg des Pendels vom Ende des Falls* bis zum Umkehrpunkt bezeichnet man als ausgehenden Ergänzungsbogen. Den Weg vom Umkehrpunkt bis zur Ruhe* nennt man eingehenden Ergänzungsbogen.
Exzenterlager
Lagerbuchse mit außermittiger Lagerbohrung. Wird als hinteres Ankerlager in die Ankerbrücke* Ihrer Mechanica M1 eingesetzt. Durch Verdrehen des Exzenterlagers kann der Achsabstand von Ankerrad*- und Ankerwelle und damit ein gleichmäßiger Fall* eingestellt werden.
Facettierte Gläser:
Als Facette werden bei Glas oder Edelsteinen angeschliffene Kanten oder Flächen bezeichnet. Diese bewirken eine unterschiedliche Brechung des Strahlengangs und erzeugen so interessante Ansichten der dahinter liegenden oder sich auf ihnen spiegelnden Objekten. Zur Aufwertung Ihrer Mechanica M1 bieten wir als Zubehör einen Satz facettierter Gläser an.
Fall
Freie Bewegung des Ankerrads, nachdem der Ankerradzahn von der Hebefläche* des Ankers abgeglitten ist. Der Fall ist eine notwendige Sicherheitsgröße, um ein Aufstoßen der Ankerpaletten* auf die Ankerradzähne zu vermeiden.
Fallhöhe
Längenmaß des für den Ablauf des Antriebsgewichts zur Verfügung stehenden Raums.
Feinregulierung
Die genaueste Justage der Schwingungsdauer des Pendels wird durch Auflage von kleinen Gewichten auf den Feinregulierteller in der Mitte des Pendelstabs erreicht. Das Zulegen von Gewichten auf den Feinregulierteller beschleunigt das Pendel, ein Abheben verzögert seine Bewegung.
Als Zubehör gibt es für Ihre Mechanica M1 ein zwölfteiliges Präzisions- Reguliergewichte-Set im zum Gehäuse passenden Edelholzetui.
Facettierte Gläser:
Als Facette werden bei Glas oder Edelsteinen angeschliffene Kanten oder Flächen bezeichnet. Diese bewirken eine unterschiedliche Brechung des Strahlengangs und erzeugen so interessante Ansichten der dahinter liegenden oder sich auf ihnen spiegelnden Objekten. Zur Aufwertung Ihrer Mechanica M1 bieten wir als Zubehör einen Satz facettierter Gläser an.
Friktion
Reibung. Generell wurde bei der Konstruktion Ihrer Mechanica M1 auf die Verminderung auftretender Reibung größter Wert gelegt. Deshalb sind bei Ihrer Mechanica M1 alle Räderwerkswellen mit Kugellagern* ausgestattet. Andererseits kann Friktion auch gezielt zum Einsatz kommen, beispielsweise als Rutschkupplung im Zeigerwerk*, um ein Stellen der Zeiger zu ermöglichen.
Gang
Unter dem täglichen Gang einer Uhr versteht der Fachmann die in einem Zeitraum von 24 Stunden im Vergleich zu einer Normaluhr auftretende Differenz der Zeitanzeige der zu prüfenden Uhr.
Gangdauer
Zeitraum zwischen zwei Aufzugsvorgängen. Die Gangdauer der Uhr hängt von der Fallhöhe* des Gewichts, den Abmessungen der Seilwalze* und von den Übersetzungsverhältnissen* im Räderwerk* ab. Bei Ihrer Mechanica M1 beträgt die Gangdauer 30 Tage = Monatsgangdauer.
Gebläut
Siehe Bläuen.
Gegengesperr
Baugruppe, bestehend aus Gegensperrrad, Gegensperrfeder und Gegensperrklinke. Es gewährleistet die Kraftversorgung des Uhrwerks während des Aufziehvorgangs.
Gesperr
Baugruppe aus Sperrrad, Sperrkegel und Sperrkegelfeder. Das Gesperr bewirkt eine in einer Bewegungsrichtung starre Verbindung zwischen der Seilwalze* und dem Räderwerk*. Damit Sie Ihre Uhr aufziehen können, ermöglicht das Gesperr eine der Ablaufrichtung entgegen gesetzte Bewegung und trennt dabei die Seilwalze vom Räderwerk.
Gleitlager
Lagerstelle, wobei der Lagerzapfen in einer Lagerbohrung gelagert ist. Da die Materialoberflächen aufeinander gleiten, ist neben der Wahl unterschiedlicher Werkstoffe unbedingt ein Schmiermittel zu verwenden.
Grahamhemmung
Ruhende Ankerhemmung, 1720 von dem Londoner Uhrmacher George Graham erfunden. Aufgrund der speziellen Form der Ankerpaletten* steht das Ankerrad während der sogenannten „Ruhe“ still. Die Grahamhemmung ermöglichte einen enormen Fortschritt in der Präzisionszeitmessung und hat sich seit Jahrhunderten selbst in feinsten Uhren hervorragend bewährt.
Grobregulierung
Einstellen der Ganggenauigkeit Ihrer Mechanica M1 mit Hilfe der Reguliermutter* am unteren Pendelende. Sie können so den Gang* der Uhr auf etwa eine Sekunde am Tag trimmen.
Hebefläche
Fläche an den Ankerpaletten*. Auf der schiefen Ebene der Hebefläche gleitet die Zahnspitze des Ankerrads während der Hebung ab und erteilt so dem Gangregler einen Antriebsimpuls.
Hebung
Phase der Hemmung*, während der die Impulsübertragung zum Antrieb des Pendels erfolgt.
Hemmung
Baugruppe bestehend aus Ankerrad* und Anker. Die Hemmung erteilt dem Gangregler die zum Erhalt der Schwingung notwendige Energie und hemmt gleichzeitig das Räderwerk* am vorzeitigen Ablauf.
Hemmungsrad
Siehe Ankerrad.
Messing
Legierung aus Kupfer und Zink. Bei Ihrer Mechanica M1 sind die Zahnräder aus Messing. Diese wurden zum Schutz gegen Korrosion und zur Oberflächenveredelung vergoldet.
Minutenrad
Zahnrad auf der Minutenzeigerwelle. Es dreht sich einmal in der Stunde und überträgt die Antriebskraft auf das Kleinbodentrieb.
Monatsgangdauer
Siehe Gangdauer.
Neusilber-Gewichte
Neusilber: Legierung aus etwa 50% Kupfer, 25% Nickel und 25% Zink. Material der als Zubehör erhältlichen Zulagegewichte* im Präzisions- Reguliergewichte-Set.
Ölsenkung
Bei Gleitlagern* halbkugelförmige Höhlung an der äußeren Lagerlochöffnung. Die Ölsenkung dient zur Aufnahme eines kleinen Ölvorrats.
Invar
Eine spezielle Eisen-Nickel Legierung aus 36,8% Ni ( Nickel ), Rest Fe ( Eisen ). Die Längenausdehnung von getempertem Invar ist bei Temperaturschwankungen etwa zehn mal geringer als bei Stahl. Die besondere Zusammensetzung wurde nach umfangreichen Studien Ende des 19. Jahrhunderts von Charles-Édouard Guillaume gefunden und von Sigmund Riefler 1896 erstmals als Werkstoff für Pendelstäbe in Präzisionsuhren verwendet.
Isochronismus
Zeitgleichheit der einzelnen Schwingungen des Gangreglers.
Kaliber
Typbezeichnung eines Uhrwerks.
Kleinbodenrad
Zahnrad im Räderwerk*. Es sitzt auf dem Kleinbodentrieb und greift in das Ankerradtrieb ein.
Kompensationspendel
Gangregler, der aufgrund seiner speziellen Konstruktion bei Temperaturschwankungen die wirksame Pendellänge nicht verändert.
Kompensationsrohr
Bauteil des Pendels. Es sitzt auf der Reguliermutter* auf und kompensiert die Längenausdehnung des Invarpendelstabs.
Kontermutter
Rändelmutter, am Pendelstab unterhalb der Reguliermutter* angebracht. Wird gegen die Reguliermutter geschraubt und sichert diese vor unbeabsichtigter Verdrehung.
Konzentrisch
Zwei Bauteile oder Kreise haben einen gemeinsamen Mittelpunkt.
Kugellager
Wälzlager, bei dem Kugeln in einer Rille zwischen dem Innen- und dem Außenring abrollen. Da die dabei auftretende Rollreibung sehr gering ist, zeichnen sich Kugellager durch geringste Reibungsverluste und nahezu keinen Verschleiß aus. Bei den geringen Belastungen der in Ihrer Mechanica M1 verwendeten Edelstahl-Kugellager benötigen diese kein Öl.
Lünette
Zierreif für das Zifferblatt.
Palette
Funktionsteil des Ankers, aus gehärtetem Stahl oder Stein. Die Paletten sind in den Ankerkörper eingesetzte Kreisringsegmente, deren Mittelpunkt der Ankerdrehungspunkt bildet. Die polierten schrägen Schnittflächen heißen Hebeflächen*. Für Ihre Mechanica M1 sind als Zubehör Steinpaletten aus Achat erhältlich.
Pendel
Auch heute noch das genaueste mechanische Schwingsystem. Die Schwingungsdauer wird durch die Pendellänge und die Erdanziehung bestimmt.
Pendelfeder
In Messingbacken gefasste Federstahllamelle, an der das Pendel* aufgehängt wird. Die Pendelfeder wird in den Pendelgalgen eingehängt.
Pendelzylinder
Schwerer zylindrischer Pendelkörper am unteren Ende des Pendelstabs. Bei Ihrer Mechanica M1 wahlweise aus massivem Edelstahl* oder Bronze*.
Pendellinse
Linsenförmiges Pendelgewicht, das durch die aerodynamisch optimierte Form besonders gute Gangeigenschaften zeigt. Für Ihre Mechanica M1 ist als Zubehör eine Pendellinse aus massiver, feingedrehter und anschließend polierter Bronze* erhältlich. Diese wird auf Wunsch auch vernickelt geliefert. Die eingefräste fortlaufende Nummerierung ist besonders für Sammler interessant.
Pfeiler
Auch Werkpfeiler genannt. Abstandshalter zwischen den Werkplatinen* und bilden mit diesen das Werkgestell.
Platinen
Werkplatten einer Uhr. Dienen zur Aufnahme der Lagerstellen und zur Fixierung der übrigen Werkbauteile. Bei Ihrer Mechanica M1 sind die Platinen aus eloxiertem* Aluminium.
Präzisionspendeluhr
Konstruktiv und fertigungstechnisch bedingungslos umgesetztes Zeitmessgerät, das sich durch hohe Gangleistungen auszeichnet. Pendeluhren mit kompensierten Pendeln wurden bis in die späten 1960-er Jahre als Zeitnormale für wissenschaftliche Zwecke und für die offizielle Zeitbestimmung eingesetzt.
Räderwerk
Zahnradgetriebe in einer Uhr. Das Räderwerk überträgt die Antriebskraft an die Hemmung*. Es ist so berechnet, dass sich einzelne Wellen* in bestimmten Geschwindigkeiten drehen.
Räderwerk
Zahnradgetriebe in einer Uhr. Das Räderwerk überträgt die Antriebskraft an die Hemmung*. Es ist so berechnet, dass sich einzelne Wellen* in bestimmten Geschwindigkeiten drehen.
Reglage
Siehe Fein- und Grobregulierung.
Regulatoranzeige
Spezielle Form der Zeitanzeige bei klassischen Präzisionspendeluhren*. Der Stundenzeiger ist außermittig angebracht und zeigt die Stunden auf einem separaten kleinen Ziffernkreis. Durch diese Anordnung kann der Stundenzeiger nicht für einige Stunden täglich den Blick auf die bei Präzisionsuhren so wichtige Sekundenanzeige versperren. Für Ihre Mechanica M1 ist als Zubehör eine Regulatoranzeige erhältlich.
Reguliermutter
Rändelmutter am unteren Pendelende. Mit ihrer Hilfe kann der Pendelzylinder* längs der Pendelstange verschoben und somit die Uhr reguliert werden. Verschiebt man den Pendelzylinder nach oben, wird das Pendel verkürzt und es erfolgt eine Beschleunigung der Pendelschwingung. Die Uhr geht schneller.
Regulierstift
Zylindrischer Edelstahlstift, der während der Reglage* in die Querbohrung an der Pendelspitze eingeschoben wird. Mit seiner Hilfe kann man das Pendel beim Verdrehen der Reguliermutter* festhalten und so die empfindliche Pendelfeder* vor Beschädigungen schützen.
Rubin
Sehr hartes Mineral aus der Familie des Korund. Künstliche Rubine werden in hochwertigen Uhren als Lagersteine verwendet. Für Ihre Mechanica M1 gibt es im Zubehör als Ersatz für die serienmäßigen Messingbuchsen verschleißfreie, in Chatons* gefasste Rubinlochsteine für Exzenter*- und Ankerlager.
Ruhe
Als Ruhe wird die kleine Distanz auf der Ruhefläche* bezeichnet, die der Ankerradzahn vom Punkt des Auftreffens auf die Ruhefläche bis zum Abgleiten auf die Hebefläche zurücklegt. Die Ruhe ist eine notwendige Sicherheitsgröße die verhindert, dass der Ankerradzahn direkt auf die Hebefläche auftritt und damit das Weiterschwingen des Pendels blockiert.
Ruhefläche
Bezeichnung für den äußeren Radius der Eingangspalette und den inneren Radiuns der Ausgangspalette auf welche die Zähne des Ankerrads* für die Hemmung* des Räderwerks* fallen.
Rundlauffehler
Resultat von Fertigungstoleranzen. Aufgrund präziser Einzelteilfertigung in unserer Manufaktur können wir den Rundlauffehler unter zwei Hundertstel Millimeter reduzieren.
Ruthenium
Ruthenium ist ein seltenes Übergangsmetall der Platinmetalle.
Es steht im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol Ru und der Ordnungszahl 44.
(Ruthenium: von lat. ruthenia: „Russland“, das Heimatland des Entdeckers)
Seilwalze
Zylindrischer Körper auf der Walzenradwelle*. Beim Aufziehen des Antriebsgewichts wird das Stahlseil auf die Umfangsfläche der Seilwalze gewickelt. Damit die einzelnen Seilumgänge nicht aneinander reiben, sind bei Ihrer Mechanica M1 schraubenförmige Führungsnuten angebracht.
Stahlwelle
Siehe Welle.
Stand
Wert um den die Anzeige Ihrer Mechanica M1 gegenüber der Referenzzeit abweicht.
Stundenrad
Bauteil des Zeigerwerks*. Das Stundenrad wird vom Wechseltrieb* angetrieben und dreht sich einmal in zwölf Stunden. Der Stundenzeiger wird auf dem mit dem Stundenrad fest verbundenen Stundenrohr aufgesetzt.
Superinvar
Besonders aufwändig getempertes Invar* mit sehr gleichmäßigem Temperaturverhalten
Teilung
Der Abstand zweier aufeinander folgender Zahnspitzen, auf den Umfang des Rads bezogen.
Tempern
Wärmebehandlung der Invarpendelstäbe* zum Abbau der Materialspannungen. Nur durch das aufwändige Tempern kann das konstante Temperaturverhalten der Pendelstäbe erreicht werden.
Trieb
Zahnrad mit weniger als 20 Zähnen; meist aus Stahl. In Ihrer Mechanica M1 sind fünf gehärtete Stahltriebe eingebaut: Beisatztrieb, Minutentrieb, Kleinbodentrieb, Ankerradtrieb und Wechseltrieb.
Übersetzung
Drehmomentübertragung* in einem Eingriff*. Dabei ändern sich von einer Welle* zur anderen die Drehrichtung und die Drehzahl.
Uhrenstand
Siehe Stand.
Viertelrad
Bauteil des Zeigerwerks*, wird auf die Minutenradwelle* gesetzt. Es treibt das Wechselrad*.
Walzenrad
Erstes Zahnrad im Räderwerk*. Treibt das Beisatztrieb an und sitzt zusammen mit Seilwalze*, Gesperr und Gegengesperr* auf einer Welle*.
Wechselrad
Bestandteil des Zeigerwerks*. Es sitzt mit dem Wechseltrieb auf dem Wechselradpfosten und wird vom Viertelrad* angetrieben.
Welle
Achse im Uhrwerk.
Wendelfeder
Druckfeder. Zu einer zylindrischen Spirale gewundener gehärteter Stahldraht. Im Abfalleinsteller* Ihrer Mechanica M1 verwendet.
Werkpfeiler
Siehe Pfeiler.
Werkplatinen
Siehe Platinen.
Wolfram
Sehr schweres Metall, Dichte 19,3 kg/dm3.
Abfalleinsteller
Vorrichtung zur Justage der Gangsymmetrie*. Mittels der Rändelschraube am Abfalleinsteller wird die Ankerwelle im Verhältnis zum Pendel* so verdreht, dass zu beiden Seiten der Ankerbewegung ein gleich großer Ergänzungsbogen* des Pendels und somit ein gleichmäßiges Tickgeräusch erzielt wird.
Achat
Hartes Mineral, das in hochwertigen Uhren für Steinpaletten verwendet wird.
Amplitude
Tischuhr: Als Amplitude wird die Halbschwingung* der Unruh* vom Nullpunkt (Mittelstellung) zu den Umkehrpunkten* bezeichnet.
Pendeluhr: Als Amplitude wird die Halbschwingung* des Pendels* von der Nulllage (Mittelstellung) zu den Umkehrpunkten* bezeichnet. Auf der Pendelskala kann die Amplitude in Winkelminuten abgelesen werden.
Aneroiddosenkompensation
Eine Möglichkeit, die Einflüsse des schwankenden Luftdrucks auf die Ganggenauigkeit der Uhr mit Hilfe eines Barometerinstruments* auszugleichen.
Ankerbrücke
Die Ankerbrücke wird mit der Hinterplatine verschraubt und dient als Aufnahme für das Exzenterlager* in dem eine Seite der Ankerwelle gelagert ist.
Ankergabel
Tischuhr: Gabelförmiger Hebelarm des Ankers. Stellt im Bereich des Nulldurchgangs* über den Hebestein* die Verbindung zwischen Ankerrad* und Unruh* her.
Pendeluhr: Ein Hebelarm, über den der Anker* mit dem Gangregler* (Pendel*) verbunden wird.
Ankerhemmung
Tischuhr: Siehe Schweizer Ankerhemmung.
Ankerpalette
Siehe Palette.
Ankerrad
Bestandteil der Hemmung*. Es dreht sich bei Ihrer Mechanica M1 alle 60 Sekunden einmal und ist mit einer Buchse auf der Ankerradwelle befestigt. Auf dem vorderen Wellenende ist der Sekundenzeiger angebracht.
Beisatzrad
Bestandteil des Räderwerks*. Es sitzt fest vernietet auf dem Beisatztrieb und sorgt für eine 30-tägige Gangdauer der Uhr. Es überträgt die Antriebskraft auf das Minutentrieb.
Bläuen
Thermische Behandlung von Kohlenstoffstählen. Das feingeschliffene oder polierte Stahlteil wird auf etwa 300° C erwärmt. Dabei bildet sich an der Oberfläche eine Oxydschicht, die für das menschliche Auge in attraktivem Blau erscheint.
Bombieren
Wölben. Besonders bei Zeigern edler Uhren gerne angewandte Methode zur Steigerung der optischen Attraktivität. Für Ihre Mechanica M1 stehen zur optischen Aufwertung aufwändig in Handarbeit bombierte, polierte und gebläute* Zeigersätze als Zubehör zur Verfügung.
Bronze
Legierungen aus mehr als 60% Kupfer und Zinn. Im Unterschied dazu ist Messing* eine Legierung aus Kupfer und Zink.
Chaton
Im feinen Uhrenbau verwendetes Messingfutter mit eingepresstem Rubinlochstein. Wird in der Platine verschraubt und kann leicht ausgetauscht werden.
CNC
Computer Numeric Controlled. Die Fertigung der präzisen Werkbauteile Ihrer Mechanica M1 erfolgt in unserer Manufaktur mit Hilfe computergesteuerter Dreh- und Fräsmaschinen.
Drehmoment
Produkt aus Kraft und Hebelarm.
Edelstahl
Durch Legieren mit anderen Metallen wie Nickel oder Chrom gewinnt der Stahl spezielle Eigenschaften, zum Beispiel erhöhte Korrosionsbeständigkeit.
Eloxieren
Elektrochemisches Altern von Aluminium. Bei dem speziellen Verfahren wird die Werkstoffoberfläche in Säurebädern behandelt, wodurch sich eine sehr widerstandsfähige Oxydschicht bildet. Bei Ihrer Mechanica M1 sind zahlreiche mechanisch gering belastete Bauteile, beispielsweise Platinen*, Ankerkörper und Seilwalze* aus eloxiertem Aluminium.
Eingriff
Das Ineinandergreifen von Rad* und Trieb* oder zweier Zahnräder nennt man Eingriff. Die Kraftübertragung wird umso besser, je mehr Zähne sich dabei gleichzeitig berühren.
Ergänzungsbogen
Schwingungsphase des Pendels. Den Weg des Pendels vom Ende des Falls* bis zum Umkehrpunkt bezeichnet man als ausgehenden Ergänzungsbogen. Den Weg vom Umkehrpunkt bis zur Ruhe* nennt man eingehenden Ergänzungsbogen.
Exzenterlager
Lagerbuchse mit außermittiger Lagerbohrung. Wird als hinteres Ankerlager in die Ankerbrücke* Ihrer Mechanica M1 eingesetzt. Durch Verdrehen des Exzenterlagers kann der Achsabstand von Ankerrad*- und Ankerwelle und damit ein gleichmäßiger Fall* eingestellt werden.
Facettierte Gläser:
Als Facette werden bei Glas oder Edelsteinen angeschliffene Kanten oder Flächen bezeichnet. Diese bewirken eine unterschiedliche Brechung des Strahlengangs und erzeugen so interessante Ansichten der dahinter liegenden oder sich auf ihnen spiegelnden Objekten. Zur Aufwertung Ihrer Mechanica M1 bieten wir als Zubehör einen Satz facettierter Gläser an.
Fall
Freie Bewegung des Ankerrads, nachdem der Ankerradzahn von der Hebefläche* des Ankers abgeglitten ist. Der Fall ist eine notwendige Sicherheitsgröße, um ein Aufstoßen der Ankerpaletten* auf die Ankerradzähne zu vermeiden.
Fallhöhe
Längenmaß des für den Ablauf des Antriebsgewichts zur Verfügung stehenden Raums.
Feinregulierung
Die genaueste Justage der Schwingungsdauer des Pendels wird durch Auflage von kleinen Gewichten auf den Feinregulierteller in der Mitte des Pendelstabs erreicht. Das Zulegen von Gewichten auf den Feinregulierteller beschleunigt das Pendel, ein Abheben verzögert seine Bewegung.
Als Zubehör gibt es für Ihre Mechanica M1 ein zwölfteiliges Präzisions- Reguliergewichte-Set im zum Gehäuse passenden Edelholzetui.
Facettierte Gläser:
Als Facette werden bei Glas oder Edelsteinen angeschliffene Kanten oder Flächen bezeichnet. Diese bewirken eine unterschiedliche Brechung des Strahlengangs und erzeugen so interessante Ansichten der dahinter liegenden oder sich auf ihnen spiegelnden Objekten. Zur Aufwertung Ihrer Mechanica M1 bieten wir als Zubehör einen Satz facettierter Gläser an.
Friktion
Reibung. Generell wurde bei der Konstruktion Ihrer Mechanica M1 auf die Verminderung auftretender Reibung größter Wert gelegt. Deshalb sind bei Ihrer Mechanica M1 alle Räderwerkswellen mit Kugellagern* ausgestattet. Andererseits kann Friktion auch gezielt zum Einsatz kommen, beispielsweise als Rutschkupplung im Zeigerwerk*, um ein Stellen der Zeiger zu ermöglichen.
Gang
Unter dem täglichen Gang einer Uhr versteht der Fachmann die in einem Zeitraum von 24 Stunden im Vergleich zu einer Normaluhr auftretende Differenz der Zeitanzeige der zu prüfenden Uhr.
Gangdauer
Zeitraum zwischen zwei Aufzugsvorgängen. Die Gangdauer der Uhr hängt von der Fallhöhe* des Gewichts, den Abmessungen der Seilwalze* und von den Übersetzungsverhältnissen* im Räderwerk* ab. Bei Ihrer Mechanica M1 beträgt die Gangdauer 30 Tage = Monatsgangdauer.
Gebläut
Siehe Bläuen.
Gegengesperr
Baugruppe, bestehend aus Gegensperrrad, Gegensperrfeder und Gegensperrklinke. Es gewährleistet die Kraftversorgung des Uhrwerks während des Aufziehvorgangs.
Gesperr
Baugruppe aus Sperrrad, Sperrkegel und Sperrkegelfeder. Das Gesperr bewirkt eine in einer Bewegungsrichtung starre Verbindung zwischen der Seilwalze* und dem Räderwerk*. Damit Sie Ihre Uhr aufziehen können, ermöglicht das Gesperr eine der Ablaufrichtung entgegen gesetzte Bewegung und trennt dabei die Seilwalze vom Räderwerk.
Gleitlager
Lagerstelle, wobei der Lagerzapfen in einer Lagerbohrung gelagert ist. Da die Materialoberflächen aufeinander gleiten, ist neben der Wahl unterschiedlicher Werkstoffe unbedingt ein Schmiermittel zu verwenden.
Grahamhemmung
Ruhende Ankerhemmung, 1720 von dem Londoner Uhrmacher George Graham erfunden. Aufgrund der speziellen Form der Ankerpaletten* steht das Ankerrad während der sogenannten „Ruhe“ still. Die Grahamhemmung ermöglichte einen enormen Fortschritt in der Präzisionszeitmessung und hat sich seit Jahrhunderten selbst in feinsten Uhren hervorragend bewährt.
Grobregulierung
Einstellen der Ganggenauigkeit Ihrer Mechanica M1 mit Hilfe der Reguliermutter* am unteren Pendelende. Sie können so den Gang* der Uhr auf etwa eine Sekunde am Tag trimmen.
Hebefläche
Fläche an den Ankerpaletten*. Auf der schiefen Ebene der Hebefläche gleitet die Zahnspitze des Ankerrads während der Hebung ab und erteilt so dem Gangregler einen Antriebsimpuls.
Hebung
Phase der Hemmung*, während der die Impulsübertragung zum Antrieb des Pendels erfolgt.
Hemmung
Baugruppe bestehend aus Ankerrad* und Anker. Die Hemmung erteilt dem Gangregler die zum Erhalt der Schwingung notwendige Energie und hemmt gleichzeitig das Räderwerk* am vorzeitigen Ablauf.
Hemmungsrad
Siehe Ankerrad.
Messing
Legierung aus Kupfer und Zink. Bei Ihrer Mechanica M1 sind die Zahnräder aus Messing. Diese wurden zum Schutz gegen Korrosion und zur Oberflächenveredelung vergoldet.
Minutenrad
Zahnrad auf der Minutenzeigerwelle. Es dreht sich einmal in der Stunde und überträgt die Antriebskraft auf das Kleinbodentrieb.
Monatsgangdauer
Siehe Gangdauer.
Neusilber-Gewichte:
Neusilber: Legierung aus etwa 50% Kupfer, 25% Nickel und 25% Zink. Material der als Zubehör erhältlichen Zulagegewichte* im Präzisions- Reguliergewichte-Set.
Ölsenkung
Bei Gleitlagern* halbkugelförmige Höhlung an der äußeren Lagerlochöffnung. Die Ölsenkung dient zur Aufnahme eines kleinen Ölvorrats.
Invar
Eine spezielle Eisen-Nickel Legierung aus 36,8% Ni ( Nickel ), Rest Fe ( Eisen ). Die Längenausdehnung von getempertem Invar ist bei Temperaturschwankungen etwa zehn mal geringer als bei Stahl. Die besondere Zusammensetzung wurde nach umfangreichen Studien Ende des 19. Jahrhunderts von Charles-Édouard Guillaume gefunden und von Sigmund Riefler 1896 erstmals als Werkstoff für Pendelstäbe in Präzisionsuhren verwendet.
Isochronismus
Zeitgleichheit der einzelnen Schwingungen des Gangreglers.
Kaliber
Typbezeichnung eines Uhrwerks.
Kleinbodenrad
Zahnrad im Räderwerk*. Es sitzt auf dem Kleinbodentrieb und greift in das Ankerradtrieb ein.
Kompensationspendel
Gangregler, der aufgrund seiner speziellen Konstruktion bei Temperaturschwankungen die wirksame Pendellänge nicht verändert.
Kompensationsrohr
Bauteil des Pendels. Es sitzt auf der Reguliermutter* auf und kompensiert die Längenausdehnung des Invarpendelstabs.
Kontermutter
Rändelmutter, am Pendelstab unterhalb der Reguliermutter* angebracht. Wird gegen die Reguliermutter geschraubt und sichert diese vor unbeabsichtigter Verdrehung.
Konzentrisch
Zwei Bauteile oder Kreise haben einen gemeinsamen Mittelpunkt.
Kugellager
Wälzlager, bei dem Kugeln in einer Rille zwischen dem Innen- und dem Außenring abrollen. Da die dabei auftretende Rollreibung sehr gering ist, zeichnen sich Kugellager durch geringste Reibungsverluste und nahezu keinen Verschleiß aus. Bei den geringen Belastungen der in Ihrer Mechanica M1 verwendeten Edelstahl-Kugellager benötigen diese kein Öl.
Lünette
Zierreif für das Zifferblatt.
Palette
Funktionsteil des Ankers, aus gehärtetem Stahl oder Stein. Die Paletten sind in den Ankerkörper eingesetzte Kreisringsegmente, deren Mittelpunkt der Ankerdrehungspunkt bildet. Die polierten schrägen Schnittflächen heißen Hebeflächen*. Für Ihre Mechanica M1 sind als Zubehör Steinpaletten aus Achat erhältlich.
Pendel
Auch heute noch das genaueste mechanische Schwingsystem. Die Schwingungsdauer wird durch die Pendellänge und die Erdanziehung bestimmt.
Pendelfeder
In Messingbacken gefasste Federstahllamelle, an der das Pendel* aufgehängt wird. Die Pendelfeder wird in den Pendelgalgen eingehängt.
Pendelzylinder
Schwerer zylindrischer Pendelkörper am unteren Ende des Pendelstabs. Bei Ihrer Mechanica M1 wahlweise aus massivem Edelstahl* oder Bronze*.
Pendellinse
Linsenförmiges Pendelgewicht, das durch die aerodynamisch optimierte Form besonders gute Gangeigenschaften zeigt. Für Ihre Mechanica M1 ist als Zubehör eine Pendellinse aus massiver, feingedrehter und anschließend polierter Bronze* erhältlich. Diese wird auf Wunsch auch vernickelt geliefert. Die eingefräste fortlaufende Nummerierung ist besonders für Sammler interessant.
Pfeiler
Auch Werkpfeiler genannt. Abstandshalter zwischen den Werkplatinen* und bilden mit diesen das Werkgestell.
Platinen
Werkplatten einer Uhr. Dienen zur Aufnahme der Lagerstellen und zur Fixierung der übrigen Werkbauteile. Bei Ihrer Mechanica M1 sind die Platinen aus eloxiertem* Aluminium.
Präzisionspendeluhr
Konstruktiv und fertigungstechnisch bedingungslos umgesetztes Zeitmessgerät, das sich durch hohe Gangleistungen auszeichnet. Pendeluhren mit kompensierten Pendeln wurden bis in die späten 1960-er Jahre als Zeitnormale für wissenschaftliche Zwecke und für die offizielle Zeitbestimmung eingesetzt.
Räderwerk
Zahnradgetriebe in einer Uhr. Das Räderwerk überträgt die Antriebskraft an die Hemmung*. Es ist so berechnet, dass sich einzelne Wellen* in bestimmten Geschwindigkeiten drehen.
Räderwerk
Zahnradgetriebe in einer Uhr. Das Räderwerk überträgt die Antriebskraft an die Hemmung*. Es ist so berechnet, dass sich einzelne Wellen* in bestimmten Geschwindigkeiten drehen.
Reglage
Siehe Fein- und Grobregulierung.
Regulatoranzeige
Spezielle Form der Zeitanzeige bei klassischen Präzisionspendeluhren*. Der Stundenzeiger ist außermittig angebracht und zeigt die Stunden auf einem separaten kleinen Ziffernkreis. Durch diese Anordnung kann der Stundenzeiger nicht für einige Stunden täglich den Blick auf die bei Präzisionsuhren so wichtige Sekundenanzeige versperren. Für Ihre Mechanica M1 ist als Zubehör eine Regulatoranzeige erhältlich.
Reguliermutter
Rändelmutter am unteren Pendelende. Mit ihrer Hilfe kann der Pendelzylinder* längs der Pendelstange verschoben und somit die Uhr reguliert werden. Verschiebt man den Pendelzylinder nach oben, wird das Pendel verkürzt und es erfolgt eine Beschleunigung der Pendelschwingung. Die Uhr geht schneller.
Regulierstift
Zylindrischer Edelstahlstift, der während der Reglage* in die Querbohrung an der Pendelspitze eingeschoben wird. Mit seiner Hilfe kann man das Pendel beim Verdrehen der Reguliermutter* festhalten und so die empfindliche Pendelfeder* vor Beschädigungen schützen.
Rubin
Sehr hartes Mineral aus der Familie des Korund. Künstliche Rubine werden in hochwertigen Uhren als Lagersteine verwendet. Für Ihre Mechanica M1 gibt es im Zubehör als Ersatz für die serienmäßigen Messingbuchsen verschleißfreie, in Chatons* gefasste Rubinlochsteine für Exzenter*- und Ankerlager.
Ruhe
Als Ruhe wird die kleine Distanz auf der Ruhefläche* bezeichnet, die der Ankerradzahn vom Punkt des Auftreffens auf die Ruhefläche bis zum Abgleiten auf die Hebefläche zurücklegt. Die Ruhe ist eine notwendige Sicherheitsgröße die verhindert, dass der Ankerradzahn direkt auf die Hebefläche auftritt und damit das Weiterschwingen des Pendels blockiert.
Ruhefläche
Bezeichnung für den äußeren Radius der Eingangspalette und den inneren Radiuns der Ausgangspalette auf welche die Zähne des Ankerrads* für die Hemmung* des Räderwerks* fallen.
Rundlauffehler
Resultat von Fertigungstoleranzen. Aufgrund präziser Einzelteilfertigung in unserer Manufaktur können wir den Rundlauffehler unter zwei Hundertstel Millimeter reduzieren.
Ruthenium
Ruthenium ist ein seltenes Übergangsmetall der Platinmetalle.
Es steht im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol Ru und der Ordnungszahl 44.
(Ruthenium: von lat. ruthenia: „Russland“, das Heimatland des Entdeckers)
Seilwalze
Zylindrischer Körper auf der Walzenradwelle*. Beim Aufziehen des Antriebsgewichts wird das Stahlseil auf die Umfangsfläche der Seilwalze gewickelt. Damit die einzelnen Seilumgänge nicht aneinander reiben, sind bei Ihrer Mechanica M1 schraubenförmige Führungsnuten angebracht.
Stahlwelle
Siehe Welle.
Stand
Wert um den die Anzeige Ihrer Mechanica M1 gegenüber der Referenzzeit abweicht.
Stundenrad
Bauteil des Zeigerwerks*. Das Stundenrad wird vom Wechseltrieb* angetrieben und dreht sich einmal in zwölf Stunden. Der Stundenzeiger wird auf dem mit dem Stundenrad fest verbundenen Stundenrohr aufgesetzt.
Superinvar
Besonders aufwändig getempertes Invar* mit sehr gleichmäßigem Temperaturverhalten
Teilung
Der Abstand zweier aufeinander folgender Zahnspitzen, auf den Umfang des Rads bezogen.
Tempern
Wärmebehandlung der Invarpendelstäbe* zum Abbau der Materialspannungen. Nur durch das aufwändige Tempern kann das konstante Temperaturverhalten der Pendelstäbe erreicht werden.
Trieb
Zahnrad mit weniger als 20 Zähnen; meist aus Stahl. In Ihrer Mechanica M1 sind fünf gehärtete Stahltriebe eingebaut: Beisatztrieb, Minutentrieb, Kleinbodentrieb, Ankerradtrieb und Wechseltrieb.
Übersetzung
Drehmomentübertragung* in einem Eingriff*. Dabei ändern sich von einer Welle* zur anderen die Drehrichtung und die Drehzahl.
Uhrenstand
Siehe Stand.
Viertelrad
Bauteil des Zeigerwerks*, wird auf die Minutenradwelle* gesetzt. Es treibt das Wechselrad*.
Walzenrad
Erstes Zahnrad im Räderwerk*. Treibt das Beisatztrieb an und sitzt zusammen mit Seilwalze*, Gesperr und Gegengesperr* auf einer Welle*.
Wechselrad
Bestandteil des Zeigerwerks*. Es sitzt mit dem Wechseltrieb auf dem Wechselradpfosten und wird vom Viertelrad* angetrieben.
Welle
Achse im Uhrwerk.
Wendelfeder
Druckfeder. Zu einer zylindrischen Spirale gewundener gehärteter Stahldraht. Im Abfalleinsteller* Ihrer Mechanica M1 verwendet.
Werkpfeiler
Siehe Pfeiler.
Werkplatinen
Siehe Platinen.
Wolfram
Sehr schweres Metall, Dichte 19,3 kg/dm3.
Abfalleinsteller:
Vorrichtung zur Justage der Gangsymmetrie*. Mittels der Rändelschraube am Abfalleinsteller wird die Ankerwelle im Verhältnis zum Pendel* so verdreht, dass zu beiden Seiten der Ankerbewegung ein gleich großer Ergänzungsbogen* des Pendels und somit ein gleichmäßiges Tickgeräusch erzielt wird.
Achat:
Hartes Mineral, das in hochwertigen Uhren für Steinpaletten verwendet wird.
Amplitude :
Tischuhr: Als Amplitude wird die Halbschwingung* der Unruh* vom Nullpunkt (Mittelstellung) zu den Umkehrpunkten* bezeichnet.
Pendeluhr: Als Amplitude wird die Halbschwingung* des Pendels* von der Nulllage (Mittelstellung) zu den Umkehrpunkten* bezeichnet. Auf der Pendelskala kann die Amplitude in Winkelminuten abgelesen werden.
Aneroiddosenkompensation:
Eine Möglichkeit, die Einflüsse des schwankenden Luftdrucks auf die Ganggenauigkeit der Uhr mit Hilfe eines Barometerinstruments* auszugleichen.
Ankerbrücke:
Die Ankerbrücke wird mit der Hinterplatine verschraubt und dient als Aufnahme für das Exzenterlager* in dem eine Seite der Ankerwelle gelagert ist.
Ankergabel:
Tischuhr: Gabelförmiger Hebelarm des Ankers. Stellt im Bereich des Nulldurchgangs* über den Hebestein* die Verbindung zwischen Ankerrad* und Unruh* her.
Pendeluhr: Ein Hebelarm, über den der Anker* mit dem Gangregler* (Pendel*) verbunden wird.
Ankerhemmung
Tischuhr: Siehe Schweizer Ankerhemmung.
Ankerpalette:
Siehe Palette.
Ankerrad:
Bestandteil der Hemmung*. Es dreht sich bei Ihrer Mechanica M1 alle 60 Sekunden einmal und ist mit einer Buchse auf der Ankerradwelle befestigt. Auf dem vorderen Wellenende ist der Sekundenzeiger angebracht.
Beisatzrad:
Bestandteil des Räderwerks*. Es sitzt fest vernietet auf dem Beisatztrieb und sorgt für eine 30-tägige Gangdauer der Uhr. Es überträgt die Antriebskraft auf das Minutentrieb.
Bläuen:
Thermische Behandlung von Kohlenstoffstählen. Das feingeschliffene oder polierte Stahlteil wird auf etwa 300° C erwärmt. Dabei bildet sich an der Oberfläche eine Oxydschicht, die für das menschliche Auge in attraktivem Blau erscheint.
Bombieren:
Wölben. Besonders bei Zeigern edler Uhren gerne angewandte Methode zur Steigerung der optischen Attraktivität. Für Ihre Mechanica M1 stehen zur optischen Aufwertung aufwändig in Handarbeit bombierte, polierte und gebläute* Zeigersätze als Zubehör zur Verfügung.
Bronze:
Legierungen aus mehr als 60% Kupfer und Zinn. Im Unterschied dazu ist Messing* eine Legierung aus Kupfer und Zink.
Chaton:
Im feinen Uhrenbau verwendetes Messingfutter mit eingepresstem Rubinlochstein. Wird in der Platine verschraubt und kann leicht ausgetauscht werden.
CNC:
Computer Numeric Controlled. Die Fertigung der präzisen Werkbauteile Ihrer Mechanica M1 erfolgt in unserer Manufaktur mit Hilfe computergesteuerter Dreh- und Fräsmaschinen.
Drehmoment:
Produkt aus Kraft und Hebelarm.
Edelstahl:
Durch Legieren mit anderen Metallen wie Nickel oder Chrom gewinnt der Stahl spezielle Eigenschaften, zum Beispiel erhöhte Korrosionsbeständigkeit.
Eloxieren:
Elektrochemisches Altern von Aluminium. Bei dem speziellen Verfahren wird die Werkstoffoberfläche in Säurebädern behandelt, wodurch sich eine sehr widerstandsfähige Oxydschicht bildet. Bei Ihrer Mechanica M1 sind zahlreiche mechanisch gering belastete Bauteile, beispielsweise Platinen*, Ankerkörper und Seilwalze* aus eloxiertem Aluminium.
Eingriff:
Das Ineinandergreifen von Rad* und Trieb* oder zweier Zahnräder nennt man Eingriff. Die Kraftübertragung wird umso besser, je mehr Zähne sich dabei gleichzeitig berühren.
Ergänzungsbogen:
Schwingungsphase des Pendels. Den Weg des Pendels vom Ende des Falls* bis zum Umkehrpunkt bezeichnet man als ausgehenden Ergänzungsbogen. Den Weg vom Umkehrpunkt bis zur Ruhe* nennt man eingehenden Ergänzungsbogen.
Exzenterlager:
Lagerbuchse mit außermittiger Lagerbohrung. Wird als hinteres Ankerlager in die Ankerbrücke* Ihrer Mechanica M1 eingesetzt. Durch Verdrehen des Exzenterlagers kann der Achsabstand von Ankerrad*- und Ankerwelle und damit ein gleichmäßiger Fall* eingestellt werden.
Facettierte Gläser:
Als Facette werden bei Glas oder Edelsteinen angeschliffene Kanten oder Flächen bezeichnet. Diese bewirken eine unterschiedliche Brechung des Strahlengangs und erzeugen so interessante Ansichten der dahinter liegenden oder sich auf ihnen spiegelnden Objekten. Zur Aufwertung Ihrer Mechanica M1 bieten wir als Zubehör einen Satz facettierter Gläser an.
Fall:
Freie Bewegung des Ankerrads, nachdem der Ankerradzahn von der Hebefläche* des Ankers abgeglitten ist. Der Fall ist eine notwendige Sicherheitsgröße, um ein Aufstoßen der Ankerpaletten* auf die Ankerradzähne zu vermeiden.
Fallhöhe:
Längenmaß des für den Ablauf des Antriebsgewichts zur Verfügung stehenden Raums.
Feinregulierung:
Die genaueste Justage der Schwingungsdauer des Pendels wird durch Auflage von kleinen Gewichten auf den Feinregulierteller in der Mitte des Pendelstabs erreicht. Das Zulegen von Gewichten auf den Feinregulierteller beschleunigt das Pendel, ein Abheben verzögert seine Bewegung.
Als Zubehör gibt es für Ihre Mechanica M1 ein zwölfteiliges Präzisions- Reguliergewichte-Set im zum Gehäuse passenden Edelholzetui.
Friktion:
Reibung. Generell wurde bei der Konstruktion Ihrer Mechanica M1 auf die Verminderung auftretender Reibung größter Wert gelegt. Deshalb sind bei Ihrer Mechanica M1 alle Räderwerkswellen mit Kugellagern* ausgestattet. Andererseits kann Friktion auch gezielt zum Einsatz kommen, beispielsweise als Rutschkupplung im Zeigerwerk*, um ein Stellen der Zeiger zu ermöglichen.
Gang:
Unter dem täglichen Gang einer Uhr versteht der Fachmann die in einem Zeitraum von 24 Stunden im Vergleich zu einer Normaluhr auftretende Differenz der Zeitanzeige der zu prüfenden Uhr.
Gangdauer:
Zeitraum zwischen zwei Aufzugsvorgängen. Die Gangdauer der Uhr hängt von der Fallhöhe* des Gewichts, den Abmessungen der Seilwalze* und von den Übersetzungsverhältnissen* im Räderwerk* ab. Bei Ihrer Mechanica M1 beträgt die Gangdauer 30 Tage = Monatsgangdauer.
Gebläut:
Siehe Bläuen.
Gegengesperr:
Baugruppe, bestehend aus Gegensperrrad, Gegensperrfeder und Gegensperrklinke. Es gewährleistet die Kraftversorgung des Uhrwerks während des Aufziehvorgangs.
Gegengewicht:
Der Minutenzeiger ist ein einarmiger Hebel, der durch die Einwirkungen der Schwerkraft halbstündlich wechselnd dem Uhrwerk Kraft zuführen oder entziehen würde. Um dem vorzubeugen, haben wir unter dem Zifferblatt Ihrer Mechanica M1 ein Gegengewicht auf der Minutenzeigerwelle angeordnet, wodurch der Schwerpunkt der Baugruppe in die Drehungsachse fällt und keine negativen Auswirkungen auf den genauen Gang* der Uhr ausüben kann.
Gesperr:
Baugruppe aus Sperrrad, Sperrkegel und Sperrkegelfeder. Das Gesperr bewirkt eine in einer Bewegungsrichtung starre Verbindung zwischen der Seilwalze* und dem Räderwerk*. Damit Sie Ihre Uhr aufziehen können, ermöglicht das Gesperr eine der Ablaufrichtung entgegen gesetzte Bewegung und trennt dabei die Seilwalze vom Räderwerk.
Gleitlager:
Lagerstelle, wobei der Lagerzapfen in einer Lagerbohrung gelagert ist. Da die Materialoberflächen aufeinander gleiten, ist neben der Wahl unterschiedlicher Werkstoffe unbedingt ein Schmiermittel zu verwenden.
Grahamhemmung:
Ruhende Ankerhemmung, 1720 von dem Londoner Uhrmacher George Graham erfunden. Aufgrund der speziellen Form der Ankerpaletten* steht das Ankerrad während der sogenannten „Ruhe“ still. Die Grahamhemmung ermöglichte einen enormen Fortschritt in der Präzisionszeitmessung und hat sich seit Jahrhunderten selbst in feinsten Uhren hervorragend bewährt.
Grobregulierung:
Einstellen der Ganggenauigkeit Ihrer Mechanica M1 mit Hilfe der Reguliermutter* am unteren Pendelende. Sie können so den Gang* der Uhr auf etwa eine Sekunde am Tag trimmen.
Hebefläche:
Fläche an den Ankerpaletten*. Auf der schiefen Ebene der Hebefläche gleitet die Zahnspitze des Ankerrads während der Hebung ab und erteilt so dem Gangregler einen Antriebsimpuls.
Hebung:
Phase der Hemmung*, während der die Impulsübertragung zum Antrieb des Pendels erfolgt.
Hemmung:
Baugruppe bestehend aus Ankerrad* und Anker. Die Hemmung erteilt dem Gangregler die zum Erhalt der Schwingung notwendige Energie und hemmt gleichzeitig das Räderwerk* am vorzeitigen Ablauf.
Hemmungsrad:
Siehe Ankerrad.
Kugellager:
Wälzlager, bei dem Kugeln in einer Rille zwischen dem Innen- und dem Außenring abrollen. Da die dabei auftretende Rollreibung sehr gering ist, zeichnen sich Kugellager durch geringste Reibungsverluste und nahezu keinen Verschleiß aus. Bei den geringen Belastungen der in Ihrer Mechanica M1 verwendeten Edelstahl-Kugellager benötigen diese kein Öl.
Lünette:
Zierreif für das Zifferblatt.
Messing:
Legierung aus Kupfer und Zink. Bei Ihrer Mechanica M1 sind die Zahnräder aus Messing. Diese wurden zum Schutz gegen Korrosion und zur Oberflächenveredelung vergoldet.
Minutenrad:
Zahnrad auf der Minutenzeigerwelle. Es dreht sich einmal in der Stunde und überträgt die Antriebskraft auf das Kleinbodentrieb.
Monatsgangdauer:
Siehe Gangdauer.
Neusilber-Gewichte:
Neusilber: Legierung aus etwa 50% Kupfer, 25% Nickel und 25% Zink. Material der als Zubehör erhältlichen Zulagegewichte* im Präzisions- Reguliergewichte-Set.
Ölsenkung:
Bei Gleitlagern* halbkugelförmige Höhlung an der äußeren Lagerlochöffnung. Die Ölsenkung dient zur Aufnahme eines kleinen Ölvorrats.
Invar
Eine spezielle Eisen-Nickel Legierung aus 36,8% Ni ( Nickel ), Rest Fe ( Eisen ). Die Längenausdehnung von getempertem Invar ist bei Temperaturschwankungen etwa zehn mal geringer als bei Stahl. Die besondere Zusammensetzung wurde nach umfangreichen Studien Ende des 19. Jahrhunderts von Charles-Édouard Guillaume gefunden und von Sigmund Riefler 1896 erstmals als Werkstoff für Pendelstäbe in Präzisionsuhren verwendet.
Isochronismus:
Zeitgleichheit der einzelnen Schwingungen des Gangreglers.
Kaliber:
Typbezeichnung eines Uhrwerks.
Kleinbodenrad:
Zahnrad im Räderwerk*. Es sitzt auf dem Kleinbodentrieb und greift in das Ankerradtrieb ein.
Kompensationspendel:
Gangregler, der aufgrund seiner speziellen Konstruktion bei Temperaturschwankungen die wirksame Pendellänge nicht verändert.
Kompensationsrohr:
Bauteil des Pendels. Es sitzt auf der Reguliermutter* auf und kompensiert die Längenausdehnung des Invarpendelstabs.
Kontermutter:
Rändelmutter, am Pendelstab unterhalb der Reguliermutter* angebracht. Wird gegen die Reguliermutter geschraubt und sichert diese vor unbeabsichtigter Verdrehung.
Konzentrisch:
Zwei Bauteile oder Kreise haben einen gemeinsamen Mittelpunkt.
Palette:
Funktionsteil des Ankers, aus gehärtetem Stahl oder Stein. Die Paletten sind in den Ankerkörper eingesetzte Kreisringsegmente, deren Mittelpunkt der Ankerdrehungspunkt bildet. Die polierten schrägen Schnittflächen heißen Hebeflächen*. Für Ihre Mechanica M1 sind als Zubehör Steinpaletten aus Achat erhältlich.
Pendel:
Auch heute noch das genaueste mechanische Schwingsystem. Die Schwingungsdauer wird durch die Pendellänge und die Erdanziehung bestimmt.
Pendelfeder:
In Messingbacken gefasste Federstahllamelle, an der das Pendel* aufgehängt wird. Die Pendelfeder wird in den Pendelgalgen eingehängt.
Pendelzylinder:
Schwerer zylindrischer Pendelkörper am unteren Ende des Pendelstabs. Bei Ihrer Mechanica M1 wahlweise aus massivem Edelstahl* oder Bronze*.
Pendellinse:
Linsenförmiges Pendelgewicht, das durch die aerodynamisch optimierte Form besonders gute Gangeigenschaften zeigt. Für Ihre Mechanica M1 ist als Zubehör eine Pendellinse aus massiver, feingedrehter und anschließend polierter Bronze* erhältlich. Diese wird auf Wunsch auch vernickelt geliefert. Die eingefräste fortlaufende Nummerierung ist besonders für Sammler interessant.
Pfeiler:
Auch Werkpfeiler genannt. Abstandshalter zwischen den Werkplatinen* und bilden mit diesen das Werkgestell.
Platinen:
Werkplatten einer Uhr. Dienen zur Aufnahme der Lagerstellen und zur Fixierung der übrigen Werkbauteile. Bei Ihrer Mechanica M1 sind die Platinen aus eloxiertem* Aluminium.
Präzisionspendeluhr:
Konstruktiv und fertigungstechnisch bedingungslos umgesetztes Zeitmessgerät, das sich durch hohe Gangleistungen auszeichnet. Pendeluhren mit kompensierten Pendeln wurden bis in die späten 1960-er Jahre als Zeitnormale für wissenschaftliche Zwecke und für die offizielle Zeitbestimmung eingesetzt.
Räderwerk:
Zahnradgetriebe in einer Uhr. Das Räderwerk überträgt die Antriebskraft an die Hemmung*. Es ist so berechnet, dass sich einzelne Wellen* in bestimmten Geschwindigkeiten drehen.
Reglage:
Siehe Fein- und Grobregulierung.
Regulatoranzeige:
Spezielle Form der Zeitanzeige bei klassischen Präzisionspendeluhren*. Der Stundenzeiger ist außermittig angebracht und zeigt die Stunden auf einem separaten kleinen Ziffernkreis. Durch diese Anordnung kann der Stundenzeiger nicht für einige Stunden täglich den Blick auf die bei Präzisionsuhren so wichtige Sekundenanzeige versperren. Für Ihre Mechanica M1 ist als Zubehör eine Regulatoranzeige erhältlich.
Reguliermutter:
Rändelmutter am unteren Pendelende. Mit ihrer Hilfe kann der Pendelzylinder* längs der Pendelstange verschoben und somit die Uhr reguliert werden. Verschiebt man den Pendelzylinder nach oben, wird das Pendel verkürzt und es erfolgt eine Beschleunigung der Pendelschwingung. Die Uhr geht schneller.
Regulierstift:
Zylindrischer Edelstahlstift, der während der Reglage* in die Querbohrung an der Pendelspitze eingeschoben wird. Mit seiner Hilfe kann man das Pendel beim Verdrehen der Reguliermutter* festhalten und so die empfindliche Pendelfeder* vor Beschädigungen schützen.
Rubin:
Sehr hartes Mineral aus der Familie des Korund. Künstliche Rubine werden in hochwertigen Uhren als Lagersteine verwendet. Für Ihre Mechanica M1 gibt es im Zubehör als Ersatz für die serienmäßigen Messingbuchsen verschleißfreie, in Chatons* gefasste Rubinlochsteine für Exzenter*- und Ankerlager.
Ruhe:
Als Ruhe wird die kleine Distanz auf der Ruhefläche* bezeichnet, die der Ankerradzahn vom Punkt des Auftreffens auf die Ruhefläche bis zum Abgleiten auf die Hebefläche zurücklegt. Die Ruhe ist eine notwendige Sicherheitsgröße die verhindert, dass der Ankerradzahn direkt auf die Hebefläche auftritt und damit das Weiterschwingen des Pendels blockiert.
Ruhefläche:
Bezeichnung für den äußeren Radius der Eingangspalette und den inneren Radiuns der Ausgangspalette auf welche die Zähne des Ankerrads* für die Hemmung* des Räderwerks* fallen.
Rundlauffehler:
Resultat von Fertigungstoleranzen. Aufgrund präziser Einzelteilfertigung in unserer Manufaktur können wir den Rundlauffehler unter zwei Hundertstel Millimeter reduzieren.
Ruthenium:
Ruthenium ist ein seltenes Übergangsmetall der Platinmetalle.
Es steht im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol Ru und der Ordnungszahl 44.
(Ruthenium: von lat. ruthenia: „Russland“, das Heimatland des Entdeckers)
Seilwalze:
Zylindrischer Körper auf der Walzenradwelle*. Beim Aufziehen des Antriebsgewichts wird das Stahlseil auf die Umfangsfläche der Seilwalze gewickelt. Damit die einzelnen Seilumgänge nicht aneinander reiben, sind bei Ihrer Mechanica M1 schraubenförmige Führungsnuten angebracht.
Stahlwelle:
Siehe Welle.
Stand:
Wert um den die Anzeige Ihrer Mechanica M1 gegenüber der Referenzzeit abweicht.
Stundenrad:
Bauteil des Zeigerwerks*. Das Stundenrad wird vom Wechseltrieb* angetrieben und dreht sich einmal in zwölf Stunden. Der Stundenzeiger wird auf dem mit dem Stundenrad fest verbundenen Stundenrohr aufgesetzt.
Superinvar:
Besonders aufwändig getempertes Invar* mit sehr gleichmäßigem Temperaturverhalten
Teilung:
Der Abstand zweier aufeinander folgender Zahnspitzen, auf den Umfang des Rads bezogen.
Tempern:
Wärmebehandlung der Invarpendelstäbe* zum Abbau der Materialspannungen. Nur durch das aufwändige Tempern kann das konstante Temperaturverhalten der Pendelstäbe erreicht werden.
Trieb:
Zahnrad mit weniger als 20 Zähnen; meist aus Stahl. In Ihrer Mechanica M1 sind fünf gehärtete Stahltriebe eingebaut: Beisatztrieb, Minutentrieb, Kleinbodentrieb, Ankerradtrieb und Wechseltrieb.
Übersetzung:
Drehmomentübertragung* in einem Eingriff*. Dabei ändern sich von einer Welle* zur anderen die Drehrichtung und die Drehzahl.
Uhrenstand:
Siehe Stand.
Viertelrad:
Bauteil des Zeigerwerks*, wird auf die Minutenradwelle* gesetzt. Es treibt das Wechselrad*.
Walzenrad:
Erstes Zahnrad im Räderwerk*. Treibt das Beisatztrieb an und sitzt zusammen mit Seilwalze*, Gesperr und Gegengesperr* auf einer Welle*.
Wechselrad:
Bestandteil des Zeigerwerks*. Es sitzt mit dem Wechseltrieb auf dem Wechselradpfosten und wird vom Viertelrad* angetrieben.
Welle:
Achse im Uhrwerk.
Wendelfeder:
Druckfeder. Zu einer zylindrischen Spirale gewundener gehärteter Stahldraht. Im Abfalleinsteller* Ihrer Mechanica M1 verwendet.
Werkpfeiler:
Siehe Pfeiler.
Werkplatinen:
Siehe Platinen.
Wolfram:
Sehr schweres Metall, Dichte 19,3 kg/dm3.
Müller & Sattler Uhrenbausatz GmbH
Lohenstraße 6
82166 Gräfelfing
Deutschland
- info (at) uhrenbausatz.de
- +49 (0)89 8955806-20
Newsletter anfordern
Ja, ich will immer über Neuigkeiten
von Uhrenbausatz informiert werden.
Email Adresse:
Service
+49 (0)89 8955806-20
- Montag bis Freitag
9:00 bis 16:00 Uhr - Besuchstermine nur nach vorheriger Absprache per Telefon oder Mail.
Wir bitten um ihr Verständnis!